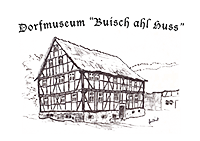Der "Haurebber"
Ein paar Gedanken vorweg:
Für manche Wörter findet man einfach keine hochdeutsche Entsprechung. Versucht man doch, sie zu übersetzen, zieht man sie unweigerlich ins Lächerliche. Oder würden Sie einen Bauern ernst nehmen, der für seine Arbeit einen Heurupfer braucht? Dabei war der Haurebber auf vielen Bauernhöfen wichtig, weil das Heu im Haustock oder Haukuur oft sehr dicht gepresst lagerte. Wollte man dann von unten an das Heu kommen, musste man schon ordentlich Kraft aufwenden. Ein bisschen rupfen reichte nicht, es musste schon mit ordentlich Schmackes gerobbt werden. So hat es Hans Feick erlebt:
Wenn ich einen Haurebber sehe, denke ich an die Zeiten, wo wir als Schulkinder beim Füttern geholfen haben. Das Heu und das Krummet hat man unten aus dem Heustock mit dem Haurebber rausgerobbt. Das war ziemlich anstrengend und darum haben wir es auch nicht gern gemacht. Bis man den Heukorb vollgerobbt hatte, da verging manchmal über eine halbe Stunde. Wenn wir aber Höhlen ins Heu gerobbt haben, da hat sich keiner beschwert. Da hat das Haurebbe Spaß gemacht. Erst im Alter hab ich es begriffen: Eine Arbeit, die einem Spaß macht, wird einem nicht zu viel.
Der Heidelbeerkamm
Wenn im Sommer viele Leute in den Wald liefen, wusste man im Dorf, es war wieder Heidelbeerzeit. Gab es viele und auch noch dicke, dann lief es wie geschmiert und das Pleggelding war bald voll. Das Pleggelding hat man sich um den Bauch gebunden. So konnte man mit zwei Händen pleggeln (pflücken). Wenn es voll war, hat man es in den großen Eimer geschüttet. Wer mit dem Beerenkamm umgehen konnte, der hatte seinen Eimer schneller voll. Es gab aber Zeiten, da war der Beerenkamm verboten, weil die Beerensträucher drunter gelitten haben. Mit vollen Eimern und schwarzen Mündern sind wir dann zusammen heimgelaufen. Durchs Dorf haben wir gesungen: „Hollerdiboller, die Beerleut kommen, unten voll, oben voll, mittendrin sind Blätter.“
Die Dorfglocke
Wenn man früher etwas bekannt machen wollte, musste man zum Ortsdiener gehen. Der lief dann mit der großen Glocke durchs Dorf und hat die Neuigkeiten verkündet. Da gab es mal eine schöne Bekanntmachung im Schlitzerland, über die die Leute heute noch lachen:
Morgen früh um halb elf soll die ganze Gemeinde... Hundevieh, mach mir nicht ans Bein!
am Transfon-mann.... Transff-ffonmann... Donnerwetter, ihr mit euren verdammten Fremdwörtern! ...am Lichthäuschen sein!
Am Backhaus steht der Hugo Loch aus Schlitz und verkauft Zwetschgen. Süße und saure. Das Pfund für dreißig Pfennig. Und wer drei Pfund kauft, bekommt sie schon für eine Mark. So, jetzt wisst ihr Bescheid.
Der Dickmilchtopf
Debbe-Heiche (auf Hochdeutsch wäre das wohl der Töpfe-Heinrich) hier aus Schlitz hat Töpfe in großer Menge hergestellt. Aus braunem Ton, bunt bemalt und glasiert. Im Westerwald gab es graue Töpfe ohne Verzierung, die waren härter gebrannt und haben besser gehalten. Man konnte sie nicht so leicht zerbrechen.
In jeder Hofreite gab es eine Menge große und kleine Töpfe. Für die Milch hatte man Milchtöpfe oder Dickmilchtöpfe. Am Abend, nach dem Melken, wurden die Töpfe gefüllt und dann über Nacht stehen gelassen. Am nächsten Tag hat man den süßen Rahm mit dem Rahmlöffel abgeschöpft. Wollte man sauren Rahm, blieben die Töpfe ein paar Tage mit der Milch stehen. Auch den sauren Rahm hat man wieder abgeschöpft. Was jetzt im Topf übrig blieb, war Dickmilch (geronnene Milch).
Was war die Dickmilch so gut! Zum Abendessen gab es dazu Pellkartoffeln. Im Sommer bei der Heuernte löschte sie den Durst. Zum Kühlen hat die Bauersfrau den Dickmilchtopf in einen Wassergraben gestellt. Jetzt war so ein heißer Tag. Als die Frau den Topf aus dem Graben holte, sprang ein Frosch aus dem Dickmilchtopf. Da rief sie ganz erschrocken: „Halt, hiergeblieben! Erst wirst du abgeleckt!“ So eine Tasse Dickmilch ist doch was Gutes!“