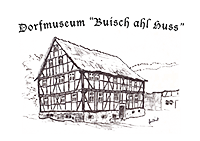Das Strommachen im Winter
Das Strommachen im Winter. Im Winter war das noch ein Problem. Bevor die Turbine angeschafft wurde, lief ja noch das Wasserrad. Wenn es kalt wurde und das Wasser am Mühlrad gefror, konnte das Rad nicht gleichmäßig laufen. Wenn es hoch ging, war es schwer und die Maschine lief langsam. Entsprechend wurde der Strom auch weniger. Und so wurden die Lampen im Dorf dunkler. Wenn die schwere Seite von oben nach unten ging, lief das Rad schneller, es gab mehr Strom und so waren die Lampen im Dorf wieder heller. Und so wusste jeder Remicher, ohne dass er vor die Tür gehen musste: Es ist halt Winter.
Was man dazu noch anmerken könnte: Das flackernde Licht im Winter war eine Sache. Eine ganz andere war es für den Müller, das festgefrorene Mühlrad überhaupt freizubekommen. Da musste dann schon mal die ganze Familie in den Mühlgraben steigen und mit Äxten die Eisschicht um das Mühlrad herum aufhacken. Das konnte ganz schön gefährlich werden: Wenn sich das Rad zu drehen begann, musste man sich eilig aus der Gefahrenzone bringen. Und das womöglich als Frau mit vom Wasser klatschnassen, schweren Trachtenröcken. Die „gute alte Zeit“ sah, was Arbeitssicherheit anging, oft nicht gerade rosig aus.
Es Wejszejch

Die Leineweberei hat im Schlitzerland lange Zeit eine große Rolle gespielt und noch heute gibt es in Schlitz Webereien, die sogar international einen sehr guten Ruf genießen. Auch in vielen Bauernhäusern standen Handwebstühle, an denen besonders im Winter viel gearbeitet wurde. Entsprechend gut gefüllt war dann auch so mancher Weißzeugschrank – nur weiß war längst nicht jedes Tuch, das sich in diesen Schränken fand. Wer gut betucht war, wollte ja auch was zum Vorzeigen haben. Buisch Liesel erzählt uns mehr davon.
Es Wejszejch
Text: Hans Feick/ gesprochen von Liesel Feick
Wer möchte, kann den Text hier noch mal auf Hochdeutsch nachlesen.
Das Weißzeug
Der Weißzeugschrank. Weißzeug ist ein uralter Ausdruck für Bett- und Tischwäsche, die gebleicht wurde. Also weiß. Später kam dann auch noch buntes Zeug dazu. Am Liebsten war den Schlitzerländern rot und blau. Alte Leute haben immer erzählt, ganz früher hätte man rote Blattläuse ausgepresst und mit dem roten Saft die Bettwäsche und die Tischdecken gefärbt. Für was die Blattläuse alles gut sein können.
Bei der blauen Farbe war es einfacher. Man hat nämlich rausgefunden, dass man mit Färberwaid einen Sud herstellen konnte, der weißes Tuch blau färbt. Später haben sie aus Indien das Indigoblau eingeführt. Das Indigoblau brauchte man nicht mit Urin anzusetzen und das hat deshalb auch nicht so gestunken. Im Weißzeugschrank war die Aussteuer der Braut untergebracht. Wenn der Schrank bis oben voll war, haben die Leute gesagt, die Braut ist gut betucht.
Dee Borteferwes

Die Schlitzerländer Tracht sticht mit ihren farbenfrohen Röcken, bunten Halstüchern und allerlei Stickereien sofort ins Auge. Besonders auffällig ist dabei das Schuhwerk. Schmiersch Anke erklärt uns, wie die Borteferwes gemacht wurden und wann man sie getragen hat.
Dee Borteferwes
Anke Schlosser
Wer möchte, kann den Text hier noch mal auf Hochdeutsch nachlesen.