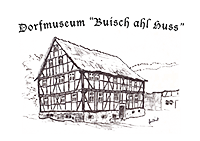De Engergrenger Heinerich
De Engergrenger Heinerich,
däihr hat gesoet: „Bee frei ich mich,
ich moß im Häescht bäj dee Soldohte,
dass wäed mi Vaddesch Jong nischt schohde.“
Si Vadder sprecht: „Min Jong, mach’s gäihn,
de konnst in Gieße vill geläihn,
doch blib mr bäj däinn freme Mäinner
nur stets en brohve Schlitzerläinner.“
Si Modder gab’m säichs Boer Stremp
onn säet’m noch: „Mach ons käinn Schemp!“
De Heinrich sprecht: „Ich wäinn’s schunn mache,
dee Chressdoe komm ich off zwo Wache.“
In Gieße geng’s dm Hei net schläicht,
e kom mit allem got seräicht,
onn bee e äescht e Zwelf geschasse,
doh konnt m’en au in Urlaub lasse.
Dass steg dm Heinrich in de Kopp,
e moecht sich fäjn, botzt Knopp fier Knopp:
So sagge se deheim noch käinner,
bass wäinn se soen, dee Schlitzerläinner!
E kom im Doerf de Ohwed o,
se woen noch grohd om Fedden dro,
doh leffe se gläjch all sesomme,
will Heinrich woer in Urlaub komme.
Onn bee se all stenn em’n remm
onn wonnen sich so remm onn dem,
doh däihnkt de Hei: Ich wäihnn’s en wiese,
bass ich geläihnt honn doet in Gieße.
„Seid mir gegrüßet, guten Tag,
wie geht es euch, verzeiht die Frag‘,
die Bauernsprach‘ kam mir abhanden,
ihr habt mich sicherlich verstanden.“
Dee Moed häitt ball en Brohl gedo,
onn alles guckt si Vadden o,
bass däih wohl dohderzo wier meine,
zon so’ner Vuernäihmheit vom Heine.
Si Vadder sprecht: „Ich mein, de wäescht
bäjm Milidär äescht zit’m Häescht.
Hast du verläihnt bee mir se schwatze,
doh wiss de demmer bee dee Katze!
Bäinn ich ons Katz noch Gieße scheck
onn hol se nohch dräij Joer sereck,
doh krischt se grohd noch bee dee Katze,
dee solang honn deheim gesatze.“
Doh hat sich onser Hei geduckt
onn hat net vuernäihm meh gegluckt,
e hat sich’s hengesch Uer geschrewe,
onn bass e woer, dass ess e blewe.
Zitiert nach: Wahl, Elisabeth (Hrsg.): Mi Schlitzerlahnd. Gedichte von Hans Steinacker, Schlitz: H. Guntrum II KG 1980.
Der Untergründer Heinrich
Heinrich, ein junger Mann aus dem Untergrund (das sind die Schlitzerländer Dörfer, die von Hutzdorf aus fuldaabwärts liegen), hatte seine Einberufung zum Wehrdienst nach Gießen erhalten. Er freute sich darauf, ging an die Angelegenheit recht selbstbewusst heran und nahm an, dass ihm die neue Erfahrung gut tun werde. Von seinen Eltern bekam er zum Abschied nicht nur sechs Paar Strümpfe, sondern auch allerhand gute Ratschläge, sich auch ja anständig zu benehmen und unter all den fremden Männern ein braver Schlitzerländer zu bleiben. Gleichzeitig empfahl ihm sein Vater aber auch, den Aufenthalt in Gießen zu nutzen und viel zu lernen. Der Heinrich konnte seine Eltern beruhigen: Er werde es schon machen und schließlich habe er zu Weihnachten Urlaub und komme für zwei Wochen heim.
In Gießen ging es ihm gut, er kam mit allem zurecht und übte sich fleißig – und erfolgreich – im Zielschießen. Gerade letzteres scheint ihm aber zu Kopf gestiegen zu sein, und so machte er sich für seinen Urlaub besonders fein, polierte ausgiebig sämtliche Knöpfe seiner Uniform und stellte sich vor, was die Schlitzerländer zu einem so schmucken Kerl wohl sagen würden. Außerdem unterlag er dem unter sehr jungen Menschen anscheinend zu allen Zeiten verbreiteten Irrtum, dass seine Mitmenschen seinesgleichen noch nie gesehen hätten.
Als er im Dorf ankam, war es Abend und die Familie gerade im Stall mit dem Füttern beschäftigt. Alle liefen zusammen, um den Heinrich zu begrüßen. Der hielt dies für eine gute Gelegenheit, seinen Lieben mal zu zeigen, was er in Gießen alles gelernt hatte, und sagte seinen Gruß in reinstem Hochdeutsch auf – die Bauernsprache habe er nämlich verlernt, aber er sei sich sicher, dass ihn alle verstanden hätten.
Sein Verhalten wirkte offenbar einigermaßen schockierend auf die Anwesenden – die Magd konnte einen Schrei nur mit Mühe unterdrücken und alle schauten auf seinen Vater, wie der wohl mit Heinrichs neugewonnener „Vornehmheit“ umgehen werde.
Der Vater war um passende Worte nicht verlegen: Der Heinrich sei doch erst seit dem Herbst beim Militär – wenn er, der Vater, aber die Hofkatze nach Gießen schicken und statt nach ein paar Monaten erst nach drei Jahren zurückholen würde, werde die noch genauso maunzen wie die Katzen, die in der Zeit zu Hause gesessen hätten. Ein so frappierender Unterschied lasse nur einen Schluss zu: Der Heinrich sei dümmer als die Katzen!
Nach dieser empfindlichen Kopfwäsche zog Heinrich den Kopf ein und gab das Hochdeutschsprechen auf. So blieb er, was er war, ein Bauer aus dem Schlitzerland, und damit auf seine ganz eigene Art vornehm.
Freie Übertragung ins Hochdeutsche: Monika Lips
Die krummen Beine
Sippels Heinrich vom Siebertshof in Schlitz hatte von Natur aus krumme Beine. Extrem krumme Beine. Ihr müsst euch das vorstellen, die waren so krumm, dass mancher sich fragte, ob man vielleicht sogar ein Fass hindurchrollen könnte. Doch, wirklich! So krumm waren die. Das war aber nicht das Schlimmste an Sippels Hei. Und für die politisch Korrekten unter uns: Es ist natürlich überhaupt nicht schlimm, wenn einer krumme Beine hat. Es macht ihn nicht zum schlechteren Menschen als die anderen. Selbstverständlich nicht. Und es kommt auch nicht darauf an, ob man da ein Fass durchrollen kann. Würde ja auch niemandem was bringen. Aber es fällt einem halt auf. Ich glaube, darauf können wir uns einigen.
Wirklich schlimm an Sippels Hei war eigentlich nur sein Mund. Der war zwar nicht äußerlich besonders – oder zumindest wissen wir nichts darüber –, aber frech war er und laut und allgemein auf Streit aus. Der Heinrich jedenfalls, der legte sich mit jedem an. Was sich, wie überall auf der Welt, auch in Schlitz nicht alle gefallen lassen wollten.
Gnisse Ludwig zum Beispiel war einer von denen, die darauf keine Lust hatten. Der war friedlich und sprach nicht viel, aber eines Tages, er saß beim Bier bei Webers Will, hatte er von der ganzen Stänkerei genug. Er kam in Wut, sprang auf und rief: „Jetzt schweigst du still!“, worauf er dem Heinrich seinen Bierkrug, noch halbvoll – oder schon halbleer, sucht es euch aus –, über den Schädel zog.
Das Bier spritzte heftig und Heinrich ging in die Knie. Sein Kopf war noch ganz, Gott sei Dank, aber eine Riesenbeule blieb zurück. Etwas Gutes hatte er aber, der Schlag: Heinrichs freches Mundwerk war fürs Erste gestopft!
Und wie es nicht anders sein kann, die Sache ging vor Gericht. Heute Nachmittag um drei war der Termin. Als die beiden Übeltäter vor dem hohen Richtertisch standen, machten sie gar keine gute Figur, waren stumm wie die Fische, und der Ludwig tat, als hätte er nichts getan.
Der Amtsrat mit dem Richterhut schaute sich die beiden an und blickte streng und dachte sich dabei: „Was doch der eine Mann für krumme Beine hat!“
Darauf sah er den Ludwig an mit stechendem Blick an und redete ihm ins Gewissen: Was er sich denn dabei gedacht habe, den Schlag so mit voller Wucht zu führen. Ob er sich überhaupt klar sei, was das für Folgen haben könne! Und schaute wieder auf den Heinrich, der – das war unvermeidlich – auf krummen Beinen vor ihm stand.
Der Ludwig verstand die Blicke und die Worte miss, bekam es mit der Angst zu tun und dachte, es gehe jetzt erstmal um des Sippels krumme Beine. Glaubte, für die werde ihm nun auch noch der Prozess gemacht. Nein, nein, Herr Richter, das sehe es falsch, das hohe Gericht! Die krummen Beine, für die könne er nichts. Auf Ehrenwort, die habe er nicht gewollt. Und der Sippels Hei, der sei von Geburt an so, die krummen Beine, die habe der schon immer gehabt!
(Sehr freie) Übertragung ins Hochdeutsche: Monika Lips
Das Üllershäuser Gänschen
Zwischen der Heu- und der Getreideernte hatten sich an der Pfordter Fuldamühle die Gänse aus dem gesamten Fuldagrund versammelt, um bei Gänsewein und Klee einmal ein ausgiebiges Palaver zu halten. Aus Hemmen waren sehr viele gekommen, die Hartershäuser hatten sogar ihre Küken dabei, und die Üllershäuser und die Pfordter Gänse schnatterten so aufgeregt, dass man kaum sein eigenes Wort verstand.
Sie redeten über die schlechten Zeiten, und wie es nur weitergehen soll, und dass man sich ja auch viel zu selten sieht. Sie schnatterten vom Kükenbrüten und vom Heiraten, und auch der Tratsch kam nicht zu kurz: Was sie nicht alles zu erzählen hatten von Gicke Grett und Gacke Hei*.
Und dann wurde auch über die Männer geschimpft: „Die lassen sich ja kaum noch zuhause blicken! Erst haben sie uns die Kinder aufgehalst, und hintenrum wird jetzt fremdgebalzt.“
Sie sprachen sich richtig aus, keinen Augenblick gaben sie Ruhe, und immer wackelten sie dabei aufgeregt mit den Schwänzen. Der Hahn aus der Pfordter Mühle, der Zeuge des ganzen Schauspiels wurde, konnte nur die Augen verdrehen. Aber was sollte man von Gänsen schon anderes erwarten?
Das Üllershäuser Gänschen aber, das saß ganz still in seiner Ecke, kaute schon seit einer halben Stunde auf einem Körnchen rum und verdarb mit seiner traurigen Miene der ganzen Gänsegesellschaft den Spaß. „Ach, ihr könnt mir’s glauben! Und so und so und überhaupt!“ Es klagte vor sich hin, grämte sich, und den anderen verging dabei das Lachen.
Die Pfordter Gans, die dick und breit und wohl ziemlich selbstzufrieden daneben saß (und die sich überhaupt nicht an dem grünen Flecken störte, den sie schon auf dem Kleid hatte), wollte die Gesellschaft beruhigen: „Ihr lieben Leute, jetzt macht mal ganz ruhig, das ist doch wirklich nichts Neues. Das hab ich doch alles schon erlebt. Wir müssen jetzt noch mal ein paar Wochen den Gürtel enger schnallen, aber danach geht’s wieder aufwärts. Dann läuft im Dorf die Dreschmaschine – sei nur geduldig, Karoline!“
Das Gänschen aus Üllershausen schaut sie fragend an: „Christine, glaubt ihr das wirklich? Ach ja, das wären ja Gottesgaben, aber ich, ich werde das nicht mehr erleben.“
*Die offiziellen Namen der beiden sind leider nicht überliefert. Wahrscheinlich sind Gicke und Gacke nur die Hausnamen und es ist gut möglich, dass die beiden sich ganz banal Fischer, Wahl oder Schmidt schrieben. Von den Taufnamen Margarete und Heinrich könnten wir dagegen mit ziemlicher Sicherheit ausgehen – wenn denn bei den Gänsen die Taufe üblich wäre…
Freie Übertragung ins Hochdeutsche: Brigitte Lips