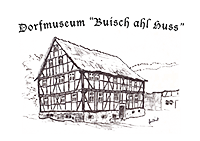Vonn de Schlitzerlänner Linnwäwer
Bei onns doa hee im Schlitzerlaand,
doa stann in jedem Huss
en Wääbstohl an de Stubewaahnd,
doa mosste nur emoa luss.
Dee Strasse nuff on widder rabb,
bei Doag onn au bei Noarscht,
doa horrt merr luut dee Wääbstehl klabber,
wuur Schlitzer Linn gemoarscht.
Noo woar im Dorf de ahle Lohn
enn Meisder in simm Fach,
häär kaant om Wääbstohl jeden Ton
woßt Bescheid in sinner Sach.
Bee dääm sinn Jorch zomm Milliedär
noahm fier sinn zweide Stohl
häär Krääters Christ sich in dee Lähr
däär koam graad uus de School.
Däär Christ däär guckt sichs oa dräj Wache
merkt sich alles ganz genau,
dann ess e sälwer hengern Stohl gekrache
onn säärt: "Dass konn ich au."
De Scheffel nie on ruff onn rapp,
de Meisder stann debei,
däär Stohl däär moarscht ruich klipp onn klapp
häär kreegs schonn in de Reih.
Uff eimoal bee ess woar gewääst
machde nääwe onn de Kaant
fenf Zendimeder lang e Nääst,
de Meisder hebt dee Hand:
"Ich kennt derr joa henger dee Uurn gefoar."
"Och Meisder, ich hatt immer noch Gleck,
bänns e beßje widdersch driewe woar,
woarsch goarnett meh uffem Steck."
(1960)
Zitiert nach Fritz Kumpf: Heiteres und Besinnliches aus dem Schlitzerland, Schlitz: Eigenverlag 2000.
Von den Schlitzerländer Leinwebern
Bei uns im Schlitzerland stand früher in jedem Haus ein Webstuhl an der Stubenwand. Überall hörte man Tag und Nacht die Webstühle klappern, wenn Schlitzer Leinen gemacht wurde. Da gab es im Dorf den alten Lohn, der war wirklich ein Meister seines Fachs. Der kannte sich richtig aus bei seiner Arbeit und am Webstuhl kannte er jeden Ton. Als sein Sohn beim Militär war, musste er für den zweiten Webstuhl einen Lehrling einstellen. Die Wahl fiel auf Krääters Christian, der gerade aus der Schule gekommen war.
Der Christian schaute sich die ganze Sache drei Wochen lang an und merkte sich alles ganz genau. Dann kroch er selber hinter den Webstuhl und sagte: "Das kann ich auch." Den Scheffel rein und auf und ab. Der Meister stand daneben, der Stuhl machte ganz ruhig sein klipp und klapp und der Christian bekam das schon ganz gut hin.
Auf einmal machte er aber neben an der Kante ein fünf Zentimeter langes Nest*. Der Meister hob schon die Hand und sprach: "Ich könnte dir eins hinter die Ohren geben." Der Christian antwortete aber "Ach Meister, ich hatte doch immer noch Glück. Wäre das ein Stückchen weiter drüben passiert, wäre es gar nicht mehr auf dem Stoff gewesen."
*Ein "Nest" ist, wie Hans Feick erklärt, der Albtraum eines jeden Webers. Dabei "verkutzeln" (verheddern) sich die Fäden so, dass an ein sauberes Weiterarbeiten nicht mehr zu denken ist.
(1960)
Zitiert nach Fritz Kumpf: Heiteres und Besinnliches aus dem Schlitzerland, Schlitz: Eigenverlag 2000.
Vom Heiraten
In diesem Gedicht geht es, wie der Titel schon sagt, um die Heiraterei, genauso sehr aber auch um das Altern. Denn wer alt wird, hat unter vielerlei Beschwerden zu leiden. Man friert, fühlt sich nicht wohl, hat keine vernünftigen Zähne mehr, Essen und Trinken machen keinen Spaß, das Laufen fällt schwer und – ja, auch das war damals offenbar ein Problem – man ist zu schwach, um den eigenen Kindern eine ordentliche Tracht Prügel zu verpassen!
Auch dem alten Adam ging es so. Ihm machte überhaupt nichts mehr Freude, aus medizinischen Gründen behalf er sich reichlich mit Korn und sein einziger Trost wäre gewesen, wenn sein Ältester, der Hannes, endlich eine Frau gefunden hätte. Aber der war im Umgang mit dem anderen Geschlecht recht schüchtern und stellte sich nach Meinung seines Vaters auch sonst so dumm an, dass er auf eine gute Partie nicht hoffen durfte.
Als der Alte das leidige Thema wieder einmal aufgewärmt und dem Hannes deutlich ins Gewissen geredet hatte, hatte dieser das Genörgel satt und war um eine Antwort nicht verlegen: „Vater, Ihr habt gut Reden. Ihr habt’ damals leicht gehabt – Ihr habt euch schließlich einfach meine Mutter genommen!“
(Sehr freie) Übertragung ins Hochdeutsche: Monika Lips
Dee Fräjeräj
Bäinn mer ahlt wead onn konn net meh rechdich gebiß,
konn dee eijene Keng net meh rechdig verschmiß,
konn mit’r Bei sich net meh gehelf,
doh gleit wohl jeder, doh schläet’s ball zwelf.
So geng’s au dm Ädche, ess moecht sich nischt meh
us Äisse onn Trenke, mennst wuesch em net schee,
brem’s ess frur, bong’s immer e Dooch ems Gesecht
onn tronk alle Dohg dräj Käinnerchen Frecht.
Sin Äilster, dr Hannes, däih konnt je gefräj,
doch e woer bäj dr Mäihderchen e beßche vill schäj,
von dr richste konnt e grohd kei gekree
von wäihjer sinner domme eifäihlt’ge Schinnee.
Onn bee no ds Ahl wieder emohl onnem woer
onn moecht em ess Fräje so rechdig kloer,
doh sprecht e: „Ach Vadder, Ihr brucht net se knoddn,
Ihr hat’s dohmohls schee, Ihr nomt Auch mi Moddn.“
Zitiert nach: Wahl, Elisabeth (Hrsg.): Mi Schlitzerlahnd. Gedichte von Hans Steinacker, Schlitz: H. Guntrum II KG 1980.